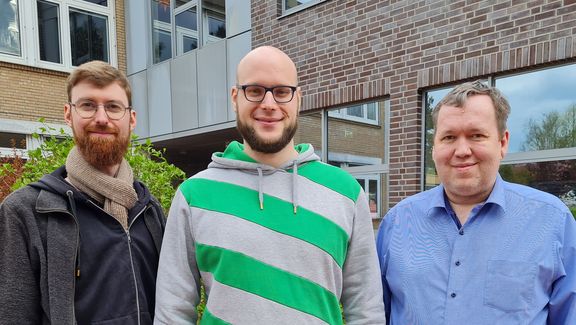Informatik am Gymnasium Papenburg
Wir alle leben in einer digitalisierten Welt. Gehen wir zum Beispiel gedanklich einmal unseren Tagesablauf von morgens bis abends durch, erleben wir eine Vielzahl von Informatiksystemen, mit denen wir bewusst oder unbewusst agieren: das Smartphone, der Filter in Foto-Apps, die Busanzeige, Social Media, die Website der Schule, das Zahlen mit der Bankkarte, KI-Anwendungen …
Doch nur wenige beschäftigen sich mit den dahinterliegenden Techniken und Ideen und bleiben deshalb nur Konsumenten. Wie funktioniert eigentlich das Internet? Was ist ein Algorithmus? Wie entwickle und programmiere ich eigene Softwareprodukte? Wie lebe ich selbstbestimmt in einer digitalisierten Welt?
Dies zu beantworten, erfordert ein vertieftes Verständnis informatischer Zusammenhänge, um über das reine Anwenden hinaus, kreativ, reflektiert und zielgerichtet mit Informatiksystemen agieren zu können.
Die dazu notwendigen Verfahren und Kenntnisse werden hier im Informatikunterricht vermittelt.
Ab dem Schuljahr 2023/24 ist Informatik ein Pflichtfach für alle Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs. Im Schuljahr 2024/25 zusätzlich für alle im neunten Jahrgang. Daraus ergeben sich Lehrstoffanpassungen in der Oberstufe, welche zu den gegebenen Zeiten auch an dieser Stelle ersichtlich werden.
Fachkollegium
Ansprechpartner
Mario Wingbermühlen
mario.wingbermuehlen@gymnasium-papenburg.de
Unterrichtsthemen
Jahrgang 9
- Computerkompetenz (z. B. sinnvoller und effektiver Umgang mit Daten: Speichern, Bearbeiten, Dateitypen, …)
- Aufbau von Computersystemen (z. B. Aufbau eines Rechners und deren Ein- und Ausgabegeräte: Mainboard, Grafikkarte, Touchscreen, …)
- Technische Informatik mit Schwerpunkt Aktorik und Sensorik
Jahrgang 10
- Vertiefende Grundlagen der Algorithmik und Programmierung mit Schwerpunkt auf Software (z. B. Scratch)
- Grundlagen der Codierung
Einführungsphase – Jahrgang 11
- Grundlagen der Algorithmik und Programmierung (grafikbasierte Programmiersprache z.B. Snap)
- Planung und Durchführung eines eigenen Softwareprojektes
- Grundlagen der Codierung
- Netzwerksysteme am Beispiel Internet
- Grundlagen der Kryptologie
Qualifikationsphase im grundlegenden Niveau
Jahrgang 12
- Vertiefung Codierung und Kryptologie
- Algorithmik, Programmierung und Datenstrukturen (textbasierte Programmiersprache z.B. Java)
- Planung und Durchführung eines eigenen Softwareprojektes
Jahrgang 13
- Theoretische Informatik: Automatenmodelle und formale Sprachen
- Grundlagen relationaler Datenbanken
- Planung und Durchführung eines eigenen Softwareprojektes
Beschreibung des Unterrichts
Im Informatikunterricht wird vor allem im Themenfeld Algorithmik und Programmierung viel mit den schuleigenen Rechnern gearbeitet. Dabei gibt es im Unterricht immer wieder längere Praxisphasen, in denen das theoretisch gelernte Wissen in selbst geschriebene Programme umgesetzt wird. Entgegen dem typischen Bild eines „Informatikers“ wird besonders Wert auf Teamarbeit und Kommunikation gelegt.
Informatik funktioniert aber auch ohne Rechner. Gerade im Themenfeld der theoretischen Informatik (Codierung, Kryptologie) wird es Unterrichtsstunden geben, in denen die Rechner kaum genutzt werden. Dabei sind diese immer nur ein Werkzeug, mit dem man nach jedem zielgerichteten Einsatz ein Stückchen besser umgehen kann.
Insgesamt wird im Informatikunterricht darauf geachtet, nicht den Umgang mit einzelnen Programmen oder Programmiersprachen zu lehren, sondern die fundamentalen Ideen dahinter zu vermitteln. Es wird also nicht die Programmiersprache Snap gelehrt, sondern mithilfe dieser Sprache die grundlegenden Mechanismen der Programmierung vermittelt.
Somit ist gewährleistet, dass die Lerninhalte auch in einem sich schnell verändernden Bereich wie der Informatik Bestand haben.
Eingesetzte Werkzeuge
- Programmierumgebungen:
- Berkeley University of California: Snap!
https://snap.berkeley.edu/ - Scratch Foundation: Scratch
https://scratch.mit.edu/ - King’s College London: Greenfoot
https://www.greenfoot.org/home - Calliope gGmbH: Calliope mini
https://calliope.cc/
- Berkeley University of California: Snap!
- Modellierumgebung:
- Dr. Stefan Freischlad: Filius
https://www.lernsoftware-filius.de/Startseite
- Dr. Stefan Freischlad: Filius
- diverse weitere, kleinere OnlineTools, um praxisorientierte Unterrichtsphasen zu ergänzen
Teilnahme an Wettbewerben
verpflichtende Teilnahme:
- Informatikbiber
https://bwinf.de/biber/ - Jugendwettbewerb Informatik
https://bwinf.de/jugendwettbewerb/
freiwillige Teilnahme:
- sprecht uns gerne an, wir haben noch etwas auf Lager!
Leistungsbewertung
Sekundarstufe I: Bewertung der Klassenarbeiten
| Zensur | ab % der erreichbaren Punkte |
|---|---|
| sehr gut | 86 |
| gut | 72 |
| befriedigend | 58 |
| ausreichend | 45 |
| mangelhaft | 20 |
| ungenügend | 00 |
Sekundarstufe II: Bewertung der Klausuren
| Notenpunkte (15-Punkte-Skala) | ab % der erreichbaren Punkte |
|---|---|
| 15 | 95 |
| 14 | 90 |
| 13 | 85 |
| 12 | 80 |
| 11 | 75 |
| 10 | 70 |
| 09 | 65 |
| 08 | 60 |
| 07 | 55 |
| 06 | 50 |
| 05 | 45 |
| 04 | 40 |
| 03 | 33 |
| 02 | 27 |
| 01 | 20 |
| 00 | 00 |
Klausuren und Gewichtung für die Gesamtnote
| Jahrgangsstufe | Klausurenanzahl | Gewichtung für die Gesamtnote Klausuren:sonstige Mitarbeit | ||
|---|---|---|---|---|
| Sek. I | 9 | epochal | 1 | 40:60 |
| 10 | epochal | 1 | 40:60 | |
| Sek. II | 11 | 1. Halbjahr | 1* | 50:50 |
| 2. Halbjahr** | 1 | 40:60 | ||
| 12 | Q1 | 1 | 40:60 | |
| Q2 (Abdeckerkurs) | 1* | 50:50 | ||
| Q2 (Prüfungskurs) | 2* | 50:50 | ||
| 13 | Q3 (Abdeckerkurs) | 1 | 40:60 | |
| Q3 (Prüfungskurs) | 2 | 50:50 | ||
| 13 | Q4 | 1 | 40:60 | |
*) Die Klausur bzw. eine der Klausuren wird ersetzt durch ein Programmierprojekt.
**) Am Ende der Jahrgangsstufe 11 wird eine Ganzjahresnote vergeben, die sich zu gleichen Anteilen aus den beiden Halbjahresnoten zusammensetzt.
KI for green: Die elften Klassen denken Künstliche Intelligenz grün
Vom 11. bis zum 17. Juni 2025 haben die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 11 in dem Workshop „KI for Green – Kann Technik nachhaltig denken?“ der Historisch-Ökologischen…
Lange Nacht der Informatik 2023 ein voller Erfolg
Von Donnerstag auf Freitag, den 22. Dezember 2023 wurde in den Computerräumen unserer Schule fleißig geschnitten, abisoliert, gelötet und programmiert. Der Informatikkurs des…
Erfolgreiche Teilnahme an Informatikwettbewerben 2023
Wie in jedem Jahr haben wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Papenburg an dem Informatik-Biber und am Jugendwettbewerb Informatik teilgenommen.
EU Code Week: Informatik für alle – 10e erstellt Informatik-Workshops
Eines ist klar: In der Welt von heute ist es unentbehrlich, sich mit Technik, digitalen Medien und Informatik auseinanderzusetzen. Um schon früh Interesse und Spaß an diesen Themen…